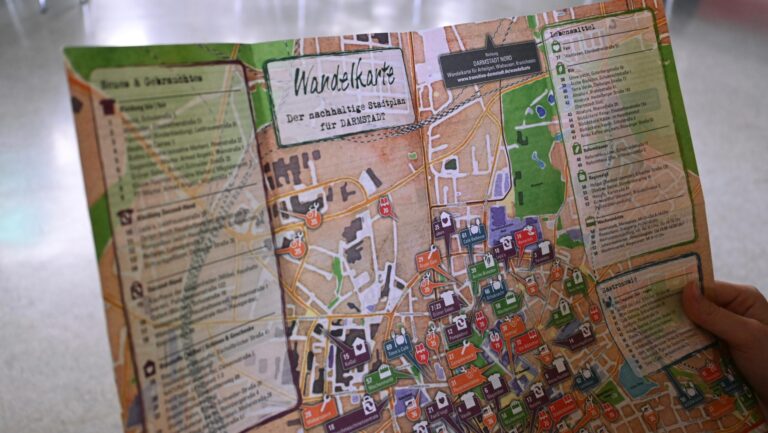Wie viel Schwammstadt steckt in Darmstadt?
Wer in die Einsteinstraße im Darmstädter Stadtteil Bessungen einbiegt, fühlt sich wie in die Zukunft versetzt. Es ist wie eine Vision vom perfekten und nachhaltigen Wohnen. Sieht so eine verantwortungsvolle Politik aus? Wie positioniert sich Darmstadt im Kampf gegen den Klimawandel? Und welche Rolle spielt dabei das Konzept von Schwammstädten?

Ein Vorzeigeprojekt für Darmstadt
Die Straße führt in die Lincoln-Siedlung, ein Wohnquartier, das ab 2016 auf ehemaligen Militärflächen von US-Soldaten nach deren Abzug im Jahr 2008 erbaut wurde. Frische Asphaltstraßen, moderne Wohnblöcke mit viel Platz zwischen den Gebäuden sowie vielfältig grün bepflanzte Flächen prägen das Stadtbild. Parkplätze sind nicht so leicht zu finden; und wenn doch mal einer frei ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um einen für E-Autos handelt. Auch ein Blick in die Höhe lohnt sich: Jede Wohnung ist mit mindestens einem Balkon ausgestattet, der durch liebevoll gepflegte Blumenkübel und Pflanzen in allen Größen akzentuiert wird. An einem warmen Sommerabend sind viele Leute auf den Straßen unterwegs, die meisten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
„Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Zur Schule ist es nicht weit und auch alle meine Freunde leben hier.“
Eleni B. (Name geändert),
wohnhaft in der Lincoln-Siedlung
Ein zentrales Element der Siedlung ist der Quartierspark, der als grüne Mitte fungiert. Dort gibt es neben einer Wiese mit geschützten Pflanzenarten auch Freizeitmöglichkeiten wie einen inklusiven Spielplatz. Die zwölfjährige Eleni, die mit ihren beiden Freundinnen Ada und Talia (Namen geändert) gerne am Spielplatz abhängt, sagt: „Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Zur Schule ist es nicht weit und auch alle meine Freunde leben hier.“ Die drei kichern und fotografieren sich gegenseitig. Infotafeln, die rund um den Quartierspark angebracht sind, vermitteln Wissen über Insekten und seltene Pflanzen. Die Architekten der Siedlung haben nicht nur an Aufklärung über Artenschutz gedacht: Im Quartierspark wurden großzügige Staudenpflanzungen mit Baumreihen bewusst so angelegt, dass sie der Entwässerung des Platzes dienen. Die Anpflanzungen in den Sand- und Kiesbeeten sollen verhindern, dass die Flächen in heißen Sommern zu stark aufheizen und austrocknen. Auch bei der Wahl der Baumarten wurde darauf geachtet, dass sie Trockenheit gut vertragen.

Die Schwammstadt – Konzept der Zukunft?
Diese Maßnahmen sind Teil eines Konzepts, das zunehmend unter dem Namen „Schwammstadt“ bekannt wird – eine Antwort auf die dringenden Herausforderungen des Klimawandels. Durch grüne Dächer, offene Flächen und spezielle Wasserwege wird Regenwasser aufgenommen, gespeichert und verzögert abgeleitet. So soll die Stadt besser vor Überschwemmungen geschützt werden, das Wasser nachhaltig genutzt und das Stadtklima verbessert werden. Eine Schwammstadt bietet Lösungen für viele Probleme, die bereits da sind und sich in Zukunft intensivieren werden. Die Umwandlung der Städte in Schwammstädte – also der klimaresistente Bau von neuen Siedlungen und die Anpassung von bereits bestehenden Gebäuden, wird in vielen deutschen Kommunen und Städten heiß diskutiert. Die Lincoln-Siedlung zeigt: Hier wurde bereits etwas getan. Doch wie ist das Engagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu beurteilen? Ist Darmstadt ein Vorreiter oder muss da noch einiges aufgeholt werden?
Anna Carmen Breuer, Klimaanpassungsmanagerin an der Hochschule Darmstadt (h_da), beurteilt Darmstadts Engagement als mittelmäßig. „Städte wie Freiburg oder Karlsruhe sind da deutlich fortschrittlicher unterwegs. Die Stadt Darmstadt verfügt jedoch über ein Amt für Klimaschutz und -anpassung – was einigen vergleichbaren Städten fehlt“, erläutert sie. Es wird auch bald ein Klimaanpassungskonzept veröffentlicht.

Markus Stippak, der stellvertretende Pressesprecher der Stadtverwaltung, sagt dazu: „Das Schwammstadtprinzip ist eine der wichtigsten Maßnahmen des Klimaanpassungsplans und fließt in zahlreiche darin aufgeführte Maßnahmen ein. Unser Ziel ist es, Darmstadt hin zu einer Schwammstadt zu entwickeln.“ Das kann durch Entsiegelungen, die Schaffung von Rückhalteflächen, die Begrünung von Dächern, die Anlage wasseroptimierter Baumstandorte und die Schaffung neuer Frei- und Grünräume erreicht werden. Auf diesen Flächen kann Regenwasser versickern, verdunsten und zurückgehalten werden.
„Unser Ziel ist es, Darmstadt hin zu einer Schwammstadt zu entwickeln.“
Markus Stippak,
stellvertretender Pressesprecher der Stadt Darmstadt
Auch die neuen Quartiere des Ludwigshöhviertels wurden als Schwammstadt entwickelt. „Das anfallende Wasser wird hier wie bei der Lincoln-Siedlung dezentral bewirtschaftet und fließt nicht mehr in die Kanalisation.“ Auch bei anderen städtischen Bauvorhaben wird das wassersensible Planen und Bauen berücksichtigt, beispielsweise durch besondere Vorgaben in den Bebauungsplänen.

Darmstadt ist besonders betroffen
Darmstadt und das Rhein-Main-Gebiet sind laut einer Klimawirkungs- und Risikoanalyse aus dem Jahr 2021 besonders stark von Hitzeperioden, Dürren und Starkregenereignissen betroffen. Die Stadt kämpft bereits mit einem ausgeprägten Wärmeinseleffekt, der zu starken Temperaturunterschieden zum Umland führen kann und eine Zunahme heißer Tage und Tropennächte prognostiziert. Anders als in vielen Städten gibt es in Darmstadt keinen offengelegten Fluss. Ein Vorteil von Fließgewässern ist, dass sie an heißen Tagen Wärme aufnehmen können. Dadurch sind die Temperaturen in ihrer Nähe oft niedriger als in weiteren Teilen der Stadt. In Darmstadt gibt es sogar ein Fließgewässer: den Darmbach – dieser verläuft größtenteils unterirdisch. Der Verein Darmbach e. V. kämpft seit Jahren für die Freilegung des Gewässers, aber die Stadtverwaltung verfolgt andere Pläne. Die Renaturierung des Darmbachs ist sogar eine im Klimaanpassungsplan aufgeführte Maßnahme. Pressesprecher Stippak weist jedoch darauf hin, dass der Darmbach im Sommer wenig bis teils kein Wasser führt. „Die reine Kühlleistung des fließenden Wassers wird keine spürbare Abkühlung in die Stadt bringen. Es müsste ein gesamtheitliches Konzept umgesetzt werden, um das Umfeld des Darmbachs flächig zu renaturieren.“ Nur so könnten Grün- und Freiflächen, aufgestaute Wasserflächen und schattenspendende Pflanzen zur messbaren Kühlung beitragen. Auch die Haushaltslage lasse eine Offenlegung des Darmbachs nicht zu.
Wer entsiegelt die meisten Flächen?
Wie können bestehende Gebäude klimaresistenter umgebaut werden? Auch bei geplanten Sanierungsvorhaben möchte die Stadt das Klima berücksichtigen. „Bei der Sanierung von Hausfassaden kann beispielsweise eine Begrünung eingeplant werden“, teilt Stippak mit. Bei Neueindeckungen von Flachdächern könne eine Dachbegrünung vorgenommen werden. Im Kontext Klimaschutz und Klimaanpassung bietet die Stadt zudem verschiedene Fördermöglichkeiten, darunter eine für PV-Anlagen sowie für Laub- und Nadelbäume.
„Um möglichst viele Flächen zu entsiegeln, soll ein Anreiz durch einen bundesweiten Wettbewerb geschaffen werden.“
Anna Carmen Breuer,
Klimaanpassungsmanagerin an der Hochschule Darmstadt
Zentral ist das Thema „Entsiegelung“, also wo auf dem Grundstück versiegelte Flächen entsiegelt werden können. Ein weiteres Anliegen ist es, die Gebäude besser abzuschatten, indem klimatolerante, großkronige Bäume gepflanzt werden. Klimaanpassungsmanagerin Breuer weiß: „Um möglichst viele Flächen zu entsiegeln, soll ein Anreiz durch einen bundesweiten Wettbewerb geschaffen werden, der vom 21. März bis zum 31. Oktober 2025 stattfindet.“ Dabei sollen möglichst viele Vorgärten oder Grundstücke begrünt werden. Ziel ist es herauszufinden, welche Stadt oder Gemeinde die meisten Flächen entsiegelt hat. Die Hochschule Darmstadt beteiligt sich aktiv an den Bemühungen der Stadt Darmstadt.
Engagement der h_da
Auch sonst versucht die Hochschule, sich den klimatischen Entwicklungen anzupassen. Breuer erklärt: „Im Allgemeinen unterscheiden wir da im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung.“ Zu ersterem zählen alle Handlungen, um den Energieverbrauch zu senken und so langfristig Emissionen zu verringern. „Darüber hinaus versuchen wir, uns den Folgen des Klimawandels – Hitze, Dürreperioden und Starkregen – anzupassen. Wir überlegen, wie der Campus so umgestaltet werden kann, dass er gegen Hitze und Starkregen gewappnet ist.“ Neben der Entsiegelung von Flächen wurden Mulden geschaffen, um Regenwasser zu speichern. „Es ist wichtig, das Klima zu schützen, damit es sich nicht noch weiter verschlechtert“, betont Breuer.